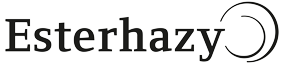Joseph Haydn und Wien

Joseph Haydn verbinden viele von uns heute wohl am ehesten mit der „Haydnstadt Eisenstadt“ – immerhin verbrachte er dort mehrere Jahrzehnte im Dienste der Fürsten Esterházy. Doch Haydn gilt nicht umsonst als einer der Großen der „Wiener Klassik“: Der Austausch mit der Wiener Musikszene trug maßgeblich zu seinem Ruhm bei und nicht zuletzt entstanden einige seiner bekanntesten Werke in der kaiserlichen Residenzstadt. Kaum verwunderlich also, dass Haydn sich manchmal dorthin sehnte, denn er vermisste nicht nur die Wiener Gesellschaft, auch die ländliche Küche konnte seiner Meinung nach mit der urbanen Kulinarik nicht mithalten. Selbst aus dem geschäftigen London schrieb er, dass ihm das ruhigere Wien fehle. Gründe genug also, Haydns Beziehung zu Wien ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen: Hier hinterfragen wir den Wahrheitsgehalt von Anekdoten aus Haydns Chorknabenzeit, entdecken, wo der große Komponist in Wien gelebt hat und erfahren, warum er sogar zum Ehrenbürger der Stadt ernannt wurde.
Haydn – Der Meister der Wiener Klassik und „seine“ Stadt
Die Stadt Wien entwickelte sich ab Mitte des 18. Jahrhunderts zu einem der bedeutendsten Musikzentren Europas. Als Residenzstadt der Habsburger zog die Stadt sowohl den Adel als auch Intellektuelle und Künstler:innen an und wurde zu einem Ort des künstlerischen Austauschs, insbesondere in der Musik. Die herausragende Stellung Wiens schlug sich sogar im Namen einer Musikepoche nieder: der „Wiener Klassik“. Joseph Haydn gilt neben W. A. Mozart und Ludwig v. Beethoven als ihr wichtigster Vertreter. Von seiner Jugend über seine Zeit am Hof der Esterházy bis zu seinem Tod blieb er der Stadt verbunden – wir skizzieren die Stationen dieser Beziehung.
Chorknabe in St. Stephan, oder: Wurde Haydn wirklich aus dem Kapellenhaus entlassen, weil er einem Mitschüler den Zopf abgeschnitten hatte?
Joseph Haydn kam bereits im Alter von acht Jahren nach Wien. Zuvor hatte er in Hainburg als Chorknabe in der Pfarrkirche gesungen, wo er von Georg Reutter d. J., dem Kapellmeister von St. Stephan in Wien, entdeckt wurde. Mit seiner „[…] schwachen, doch angenehmen stime (sic!) […]“, wie er später selbst urteilte, ersang sich der kleine „Sepperl“ einen Platz im Chor von St. Stephan:
Die Zeit im Kapellenhaus sollte seinen Karriereweg maßgeblich beeinflussen, denn er erhielt dort nicht nur fundierten Gesangs- und Instrumentalunterricht, sondern entwickelte auch eine Leidenschaft für das Komponieren. Seine frühen Werke wurden zwar von Kapellmeister Reutter korrigiert, tiefgehende Stunden in Musiktheorie waren allerdings nicht Teil des Lehrplans. Haydn soll sich daher sein dahingehendes Wissen mithilfe von Büchern wie dem Lehrbuch „Gradus ad Parnassum“ von Johann Joseph Fux selbst angeeignet haben – die Quellen hierzu sind allerdings nicht eindeutig, da dieses Selbststudium möglicherweise auch erst in die Zeit nach Haydns Entlassung aus dem Kapellhaus fiel. Mit etwa 18 Jahren vollendete er jedenfalls seine erste Messe: Die Missa brevis in F-Dur (Hob. XXII:1).
Später soll Haydn immer wieder erzählt haben, dass ihm seine schöne Stimme fast zum Verhängnis geworden wäre. Im 17. und 18. Jahrhundert wurden vor allem in Süditalien häufig Chorknaben kastriert, um den Stimmbruch zu unterbinden. Angeblich plante man auch an dem jungen „Sepperl“ eine solche Operation durchzuführen und nur das väterliche Veto bewahrte ihn vor dem Kastratenschicksal. Georg August Griesinger, einer der frühesten Biographen Haydns und ein guter Bekannter des Komponisten, schrieb dazu:
Allerdings zweifelten schon Zeitgenossen daran, dass ernsthaft eine Operation in Erwägung gezogen wurde, zumal derartige Kastrationen fast ausschließlich aus Italien bekannt waren. Sie vermuteten hinter der Anekdote eher einen Scherz des für seinen Humor bekannten Komponisten.
Apropos Humor: Um Haydns Jahre als Chorknabe ranken sich einige amüsante Geschichten, die zum Schmunzeln einladen. So soll er einst auf dem Baugerüst von Schönbrunn herumgeklettert sein, weswegen er sogar von Kaiserin Maria Theresia persönlich gerügt wurde. Wie bei vielen Anekdoten ist aber auch hier ein wenig Vorsicht geboten, denn beweisen ließ sich die Begebenheit (bislang) nicht. In einigen frühen Haydn-Biographien lesen wir zudem häufig von einem angeblichen Lausbubenstreich des jugendlichen Komponisten: Er soll einem Sängerkollegen den Zopf abgeschnitten haben, in manchen Versionen wurde er sogar deswegen aus dem Kapellhaus entlassen. Mag sein, dass der Streich seine Entlassung beschleunigte, doch der wahre Grund lag viel eher im Stimmbruch. Jedenfalls musste Haydn das Kapellhaus von St. Stephan im Jahr 1748 oder 1749 verlassen.
Haydn als junger Musiker in Wien
Nach seiner Entlassung als Chorknabe entschied sich Haydn für eine Karriere in der Musik. Bis zu seiner Anstellung am Hof der Esterházy 1761 blieb Wien sein Hauptaufenthalt.
Die Anfänge waren eher bescheiden: Ab etwa 1749 bewohnte er „[…] ein armseliges Dachstübchen […] ohne Ofen, worin er kaum gegen Regen geschützt war.“ Diese Wohnung befand sich in einem Haus am Wiener Michaelerplatz, wo auch der berühmte Hofdichter und Librettist Pietro Metastasio lebte. Von etwa 1751/52 bis 1754/55 gab Haydn der Tochter eines weiteren Bewohners Gesangs- und Klavierunterricht – Marianna von Martines sollte später eine gefeierte Pianistin werden. Zu dieser Zeit machte er außerdem Bekanntschaft mit dem Komponisten Nicola Antonio Porpora, von dem er, wie er später in einer autobiographischen Skizze festhielt, „[…] die ächten Fundamente der sez kunst […]“ erlernte. Endlich erhielt Haydn also Kompositionsunterricht!
Zwischen 1751 und 1753 arbeitete Haydn mit einem der bekanntesten Wiener Schauspieler der damaligen Zeit, Joseph Felix von Kurz, auch Bernadon genannt, zusammen. Vermutlich stehen mehrere Stücke von Bernadon mit Haydn in Verbindung, bekannt ist aber nur, dass er für das Singspiel „Der krumme Teufel“ (Hob. XXIXb:1a) die Musik komponierte. Das Stück kam im Wiener Kärntnertortheater zur Aufführung, wurde jedoch nach kurzer Zeit „[…] wegen beleidigender Anzüglichkeiten im Texte verboten“ – allzu lange hielt dieses Verbot jedoch nicht an.
Finanziell ging es dem jungen Mann, der sich seinen Lebensunterhalt auch durch Unterricht und Orgeldienste in verschiedenen Kirchen verdiente, zunehmend besser. Er dürfte schließlich aus seinem „armseligen Dachstübchen“ in eine Wohnung in die Seilerstätte umgezogen sein, die genaue Adresse ist jedoch nicht mehr bekannt.
Eine Zeit lang lebte Haydn wohl auch beim Perückenmacher Johann Peter Keller in der Landstraße 51 (heute etwa auf der Höhe Beatrixgasse 21 im dritten Wiener Gemeindebezirk). Der Überlieferung nach verliebte er sich dort in die Tochter seines Hausherren, Theresia Helena. Diese trat jedoch 1755 einem Kloster bei. Laut eigenen Aussagen komponierte Haydn zu diesem Anlass sogar ein Konzert für Orgel und Violine, vermutlich entweder das Konzert in F-Dur (Hob. XVIII:6) oder das Konzert in C-Dur (Hob. XVIII:I). Statt Theresia Helena heiratete er letztendlich deren ältere Schwester, Maria Anna Theresia.
Hochzeit in Wien: Hat Haydn heimlich geheiratet?
Zwischen 1757 und 1759 erhielt Haydn eine Stelle als Kammerkomponist und Musikdirektor, wobei er für Graf Karl Joseph Franz von Morzin arbeitete. Christoph Albert Dies, ein früher Biograph und Bekannter Haydns, schrieb dazu:
Es war Haydn also untersagt, zu heiraten. Trotzdem hielt er am 26. November 1760 in der Wiener Stephanskirche Hochzeit mit Maria Anna Theresia Keller – laut Dies heimlich. Doch kann diese Darstellung stimmen? Wenn wir bedenken, dass Angestellte eines Adeligen damals eigentlich ein Erlaubnisschreiben zur Eheschließung vorlegen mussten, entstehen Zweifel an der Geschichte. Ganz so heimlich konnte diese Heirat nur schwer stattgefunden haben.
Sehnsuchtsort Wien: Haydn zwischen Esterházy-Hof und Residenzstadt
Kurz nach seiner Heirat begann Haydns Zeit am Hof der Fürsten Esterházy: Der Dienstvertrag wurde am 1. Mai 1761 aufgesetzt. Von nun an waren seine hauptsächlichen Arbeitsorte Eisenstadt und Schloss Eszterháza in Süttör. Erst etwa drei Jahrzehnte später sollte er wieder hauptsächlich in Wien leben.
Als Angestellter der Fürsten Esterházy war Haydn an eine Regelung gebunden: Er musste sich dort aufhalten, wo seine Dienstgeber ihn wünschten. Ohne Erlaubnis durfte er demnach seinen Dienstort nicht verlassen. Wenn sich der Fürst jedoch in Wien aufhielt oder eine Reiseerlaubnis erteilte, konnte auch Haydn an der Wiener Gesellschaft teilnehmen. So kam es beispielsweise zu Begegnungen mit seinem jüngeren Kollegen Wolfgang Amadeus Mozart.
Am 11. Februar 1785 wurde Haydn zudem in die Wiener Freimaurerloge „Zur wahren Eintracht“ aufgenommen. In den folgenden Anwesenheitslisten der Loge, die kaum ein Jahr nach Haydns Eintritt aufgelöst wurde, scheint er jedoch nicht mehr auf – vermutlich, weil ihm Aufenthalte in Wien nicht möglich waren.
Haydns aktive Teilnahme am Wiener Musikleben blieb zwischen 1761 und Ende 1790 daher eher beschränkt. Zwar sind persönlich geleitete Aufführungen seiner Werke in Wien verbürgt und wurden hochgelobt, dennoch bleibt es erstaunlich, wie schnell er sich einen Namen in Europa machen konnte – trotz seiner „Ortsgebundenheit“. Schon in einer Ausgabe der „Gelehrten Nachrichten“ von 1766 wurde er als „Liebling unserer Nation“ bezeichnet und in der „Kaiserlich-Königlich allergnädigst privilegierten Realzeitung“ hieß es 1775:
Um 1789 herum schien Haydn jedoch zunehmend mit der oben genannten Dienstregelung zu hadern.
schrieb er etwa am 8. März 1789 an seinen Verleger Artaria.
Besonders unglücklich war er darüber wohl im Frühjahr 1790. Um die Jahreswende 1789/1790 verbrachte er ein paar Wochen in Wien und konnte unter anderem Proben zu Mozarts „Così fan tutte“ beiwohnen. Im Februar 1790 entschloss sich Fürst Nikolaus I. Esterházy jedoch, nach Eszterháza zu reisen. Haydn musste folgen. In einem Brief an seine Freundin Marianne Genzinger schrieb er daraufhin:
Sogar der Wiener Küche trauerte Haydn nach: Er schwärmte etwa von einem „Ragou mit kleinen Knöderl“, von Kaffee, heißer Schokolade oder Speiseeis und bezeichnete sich als „[…] Mann, welchen die Wienner zu viel gutes erwisen haben […]“
Auch ein etwas späterer Brief an Marianne Genzinger zeugt von erfolglosen Versuchen, eine Reiseerlaubnis nach Wien zu erhalten:
Geschäftiges London, gemächliches Wien: Warum Haydn die Stadt an der Donau bevorzugte
Fürst Nikolaus I. Esterházy starb am 28. September 1790. Sein Nachfolger Anton I. entließ die Hofkapelle und behielt Haydn nur noch formell im Dienst. Haydn begab sich sofort nach Wien und bezog zunächst eine Wohnung auf der Wasserkunstbastei Nr. 1196 (das Haus stand auf der Höhe der heutigen Seilerstätte Nr. 21 im ersten Wiener Gemeindebezirk). Der Wegfall seiner dienstlichen Verpflichtungen am Esterházy-Hof ermöglichte es ihm aber auch, der Einladung des Geigers und Impresarios Johann Peter Salomon zu einer Konzertreise nach London zu folgen. Es war das erste Mal, dass Haydn sein bisher hauptsächlich auf Wien, Eisenstadt und Eszterháza beschränktes Umfeld verließ.
Im Dezember 1790 brach Haydn zu seiner ersten Englandreise (1791-1792) auf und feierte große Erfolge. Doch selbst dort sehnte er sich manchmal nach Wien zurück, wie wir in einem Brief an Marianne Genzinger vom 8. Jänner 1791 lesen können:
Stilles Arbeiten fiel dem Komponisten in London offenbar schwer.
Er vermisste jedoch nicht nur die ruhigen Wiener Stunden, sondern auch sein freundschaftliches Umfeld:
schrieb er am 20. Dezember 1791 aus London. Im selben Brief lesen wir auch:
Wien schien also Haydns präferierter Wohn- und Schaffensort gewesen zu sein.
Wo kaufte Joseph Haydn in Wien ein Haus?
Zwischen seinen beiden Englandreisen (1791/92 und 1794/95) wurde Haydn zum Immobilienbesitzer. Er erwarb ein Haus in der damaligen Kleinen (auch Unteren) Steingasse Nr. 71 (später 73) in der Wiener Vorstadt „Windmühle“. Das Haus existiert bis heute, nur der Name der Gasse wurde 1862 geändert: Wir finden es in der Haydngasse Nr. 19 im sechsten Wiener Gemeindebezirk. Haydn ließ es damals umbauen, das entsprechende Ansuchen beim Magistrat der Stadt Wien ging am 14. August 1793 ein.
Nur drei Tage nachdem Haydn am 19. Jänner 1794 zu seiner zweiten Englandreise aufgebrochen war, starb Fürst Anton I. Esterházy. Antons Nachfolger Nikolaus II. wollte die Hofkapelle wieder aufbauen lassen – mit Joseph Haydn als Kapellmeister. Dieser folgte dem Ruf seines Fürsten und kehrte im Sommer 1795 aus England zurück. Da Nikolaus II. hauptsächlich in Wien und Eisenstadt residierte, konnte nun auch Haydn die meiste Zeit in Wien (mit gelegentlichen Aufenthalten in Eisenstadt) verbringen.
Welche berühmten Werke Haydns entstanden in Wien?
Mit dem „Kaiserlied“ (Hob. XXVIa:43) und den beiden Oratorien „Die Schöpfung“ (Hob. XXI:2) und „Die Jahreszeiten“ (Hob. XXI:3) schrieb Haydn zwischen ca. 1795 und ca. 1801 einige seine bekanntesten Werke in Wien. Alle drei kamen auch dort zur Uraufführung. Doch wo genau entstanden diese Meisterwerke?
Da sich sein Haus noch eine Zeit lang im Umbau befand, bezog Haydn zunächst andere Wohnungen. Eine Konzertanzeige für den 18. Dezember 1795 bestätigt, dass er damals in einer „[…] Wohnung am neuen Markte in dem Hoföbstlerischen Hause im drittem Stock […]“ wohnte (heute etwa Neuer Markt Nr. 2). Dort dürfte zwischen Oktober 1796 und Jänner 1797 das „Kaiserlied“ entstanden sein. Die Melodie wurde erstmals am 12. Februar 1797 zum 29. Geburtstag des Kaisers Franz II. in allen Theatern von Wien (und auch anderen Städten der Monarchie) angestimmt.
Während seiner Arbeit an der „Schöpfung“ im Frühjahr 1797 zog Haydn sogar extra in die Wiener Krugerstraße, um unmittelbarer mit seinem Librettisten Gottfried van Swieten zusammenarbeiten zu können. Im Sommer desselben Jahres konnte er jedoch in sein nunmehr umgebautes Haus in der Vorstadt übersiedeln. Wie die „Schöpfung“ wurde auch das spätere Werk „Die Jahreszeiten“ im Stadtpalais Schwarzenberg am Wiener Mehlmarkt (heute Neuer Markt) unter großem Beifall uraufgeführt.
Warum wurde Haydn Ehrenbürger der Stadt Wien?
Trotz seines sich zunehmend verschlechternden Gesundheitszustandes blieb Haydn bis etwa 1803 recht aktiv und dirigierte in Wien u. a. die Uraufführung seiner „Jahreszeiten“ oder Benefizkonzerte. Für derartige Wohltätigkeitsveranstaltungen wurde Haydn am 1. April 1804 die Ehrenbürgerschaft der Stadt Wien verliehen, hatte er doch in den Jahren 1801 bis 1803 unentgeltlich Aufführungen zugunsten des Wiener Bürgerspitals St. Marx geleitet. Für diese Konzerte erhielt er außerdem 1803 die zwölffache goldene Salvatormedaille.
Wie verbrachte Haydn seine letzten Jahre in Wien?
Nachdem Haydns Frau Anna Maria am 20. März 1800 in Baden bei Wien gestorben war, lebte der Komponist unter anderen mit seiner Nichte Ernestine Loder und der Köchin Anna Kremnitzer in seinem Haus. Seit einer Erkrankung im Frühjahr 1800 verschlechterte sich seine Gesundheit zusehends. In seinen letzten Jahren empfing er jedoch noch recht häufig Besuch, beispielsweise von Christoph Albert Dies. Aus den Aufzeichnungen, die Dies von jedem Besuch machte, entstand eine der frühesten Haydn-Biographien überhaupt.
Im Jahr 1808 – Haydn lebte eigentlich schon völlig zurückgezogen – folgte er der Einladung einer „Liebhabergesellschaft“, die ihm zu Ehren eine Aufführung der „Schöpfung“ im damaligen Wiener Universitätssaal (heute Festsaal der Akademie der Wissenschaften) veranstaltete. Es sollte der letzte öffentliche Auftritt des alternden Komponisten sein.
Wann starb Joseph Haydn und wo wurde er in Wien bestattet?
Haydn starb in der Nacht zum 31. Mai 1809. Seine letzten Tage waren von den Wirren der Napoleonischen Kriege überschattet. Französische Truppen waren nach Wien vorgedrungen, hatten die Stadt beschossen und schließlich besetzt. Haydn nahmen diese Geschehnisse sehr mit, wie wir aus einem Brief seines Kopisten Johann Elßler erfahren:
Am 31. Mai verschied Haydn im Beisein seiner Dienerschaft und eines Nachbarn. Der Leichnam wurde am nächsten Tag in der Pfarrkirche St. Aegyd eingesegnet und auf dem damaligen Hundsturmer Friedhof beigesetzt. Haydns vermeintlich letzte Ruhe sollte nicht lange währen – doch das ist eine andere Geschichte.
Wie gedenkt man in Wien noch heute Joseph Haydn?
Als einer der drei großen Komponisten der „Wiener Klassik“ ist Haydn bis heute im Wiener Stadtbild präsent. An sein Leben und Schaffen erinnern u. a. Gedenktafeln, das als Museum geführte „Haydnhaus“, der „Haydnpark“ auf dem Gelände des ehemaligen Hundsturmer Friedhofs und das Haydndenkmal vor der Mariahilfer Kirche im sechsten Wiener Gemeindebezirk.
Haydn selbst blieb Wien Zeit seines Lebens verbunden.