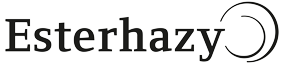Als Haydns Kopf gestohlen wurde

Am 31. Mai 1809 verstarb Joseph Haydn in Wien. Er wurde am nächsten Tag beigesetzt, doch seine letzte Ruhe sollte nicht lange ungestört bleiben. Zwei Männer ließen den Sarg heimlich nur wenige Tage später wieder ausgraben und entwandten den Schädel. Elf Jahre später ließ Fürst Nikolaus II. Esterházy das Grab erneut öffnen und fand nur den Körper – und die leere Perücke. Damit begannen die Ermittlungen rund um den Kopf von Joseph Haydn, der erst nach 145 Jahren wieder mit den übrigen Gebeinen vereint werden sollte. Wir rollen diese Kriminalgeschichte neu auf.
Ein Grab ohne Schädel
Es war etwa zwei Uhr nachmittags am 30. Oktober 1820, als Fürst Nikolaus II. Esterházy sich auf dem Hundsthurmer Friedhof in Wien einfand. Elf Jahre nach dem Tod seines Kapellmeisters wollte er nun seinem langgehegten Wunsch nachkommen, die Gebeine Haydns nach Eisenstadt zu überführen. Die Totengräber schritten zur Tat: Der Sarg wurde ausgehoben, der Deckel entfernt. Neugierige Köpfe beugten sich hinunter, willig, die sterblichen Überreste Haydns wohl ein letztes Mal zu betrachten. Doch was Fürst Esterházy und ihre Begleiter da sahen, war mehr als morbid: Der Schädel war fort – nur die Perücke lag noch da. Sofort verständigte der Fürst die Polizei. Ermittlungen begannen. Was war geschehen?
Der Tathergang
Joseph Haydn starb am 31. Mai 1809 während der französischen Besatzung Wiens unter Napoleon. In seinem Testament hatte er sich ausdrücklich ein Begräbnis erster Klasse gewünscht, doch dazu soll es aufgrund der Kriegssituation nicht kommen. Gleich am nächsten Tag wurde er am Hundsthurmer Friedhof in Wien, dem heutigen Haydnpark, bestattet. Nur wenige Gäste wohnten der Trauerfeier bei – unter ihnen befand sich ein Mann namens Joseph Carl Rosenbaum. Dieser schrieb seit 1797 gewissenhaft ein Tagebuch und notierte mittlerweile Ereignisse zu jedem Tag. So auch am 1. Juni 1809, als er Haydns Begräbnis besuchte:
So weit, so gut. Doch Rosenbaums Tagebucheintrag geht noch weiter:
Rosenbaum hatte also einen Plan: Er wollte Haydns Kopf heimlich aus dem Grab entwenden und bestach dafür den Totengräber Jakob Demuth. Sein wichtigster Komplize war ein Mann namens Johann Nepomuk Peter.
Nur vier Tage nach Haydns Beisetzung war der Betsatter Jakob Demuth bereits seinem Auftrag nachgekommen: Er hatte den Sarg des Komponisten wieder ausgegraben und den Kopf abgeschnitten. Am 4. Juni 1809 notierte Rosenbaum in seinem Tagebuch die Abholung des Schädels:
Anschließend ließen Rosenbaum und sein Kumpan Peter den Kopf präparieren:
Zur Aufbewahrung wurde ein Behältnis für den Totenschädel Haydns angefertigt. Peter verwahrte das Kästchen samt Inhalt vorerst bei sich zu Hause auf.
Die Täter
Wer waren Joseph Carl Rosenbaum und sein Komplize Johann Nepomuk Peter?
Rosenbaum kannte Haydn persönlich, denn bis 1800 war er wie der Komponist am Hof des Fürsten Nikolaus II. Esterházy angestellt und arbeitete als Kanzlist und Stallrechnungsführer. Damals schrieb er bereits fleißig Tagebuch und daher wissen wir, dass er Haydn als seinen Freund bezeichnete. Als Rosenbaum sich in die Sängerin Therese Gassmann verliebte, stieß er auf Widerstand beim Fürsten, der ihm die Erlaubnis zur Heirat nicht geben wollte. Haydn versprach sogar, sich für seinen Freund Rosenbaum bei Nikolaus II. einzusetzen, allerdings vergeblich. Erst nach jahrelangem Hinauszögern seitens des Fürsten erhielt Rosenbaum die Heiratserlaubnis – einhergehend mit einer Entlassung. Merklich gekränkt vermerkte er dazu in seinem Tagebuch:
Johann Nepomuk Peter hingegen war der der Verwalter des k. k. niederösterreichischen Provinzialstrafhauses.
Rosenbaum und Peter wurden mit der posthumen Enthauptung Haydns übrigens zu Wiederholungstätern. Etwas mehr als ein halbes Jahr davor hatten sie – auch damals unter der Mithilfe des Totengräbers Jakob Demuth – im November 1808 die sterblichen Überreste der Schauspielerin Elisabeth Roose exhumiert und ihren Schädel geraubt. Haydn wurde wie die Schauspielerin auf dem Hundsthurmer Friedhof beigesetzt, und zwar ganz in ihrer Nähe. Rosenbaum schrieb dazu in sein Tagebuch: „Er [Haydn, Anm.] liegt dem Löschenkohl zur Rechten, an dessen linken Seite die Roose ruht“. Dass „die Roose“ dort neben Haydn allerdings schon kopflos lag – durch Rosenbaum selbst verschuldet – fand in diesem Eintrag keinen Platz.
Die Tatmotive
Peter und Rosenbaum stahlen Haydns Schädel nicht für Geld oder Ruhm – sie waren von wissenschaftlichem Elan getrieben.
Im Wien um 1800 erfreute sich eine Theorie besonderer Beliebtheit, nämlich die sogenannte „Gall’sche Schedllehre“. Benannt ist sie nach ihrem Gründer, dem Arzt, Naturforscher und Anthropologen Franz Joseph Gall. Dieser ließ sich in Wien nieder, eröffnete eine Praxis und hielt Privatvorlesungen. Eine Lehre hatte es auch Laien angetan: Anhand der Schädelwölbung sollen besonders ausgeprägte Hirnareale erkennbar sein, die Rückschlüsse auf den geistigen und seelischen Zustand der Person zulassen. Besonders die „Kranioskopie“, das Abtasten der Schädel, fand Beifall und es wurde Mode unter höheren Wiener Gesellschaftskreisen, sich für Galls Lehren zu interessieren.
Auch Gall sammelte Schädel, ein Teil seiner Sammlung ist bis heute im Bestand des Rollettmuseums in Baden bei Wien. Doch seine Lehren waren Kaiser Franz II. /I. schnell ein Dorn im Auge, denn sie würden gegen jegliche „Grundsätze der Religion und Religion“ verstoßen. 1802 wurden Galls Vorlesungen verboten. Leidenschaftliche Befürworter der Lehre, wie es Paul und Rosenbaum augenscheinlich waren, hielt dieses Verbot nicht ab. Sie wollten es ihrem großen Vorbild gleichtun und eine Schädelsammlung anlegen.
Liest man Peters 1832 nachträglich verfasste „Erklärung, was mich verleitete und wie ich in den Besitz des natürlichen Kopfes von dem unsterblichen Thonkünstler Herrn Joseph Hayden, Doktor der Thonkunst, kam“, so bekommt man fast den Eindruck, als hätte er nur auf den Tod Haydns gewartet, um anhand seines Schädels die Gall’schen Theorien zu beweisen:
Tatsächlich nahmen Rosenbaum und Peter eine wissenschaftliche Untersuchung in Form einer „Kranioskopie“ an Haydns Schädel vor und waren mit dem Ergebnis zufrieden:
Aus den Aufzeichnungen Peters und Rosenbaums geht aber auch die Verehrung hervor, die sie Haydn entgegenbringen. Peter beispielsweise rechtfertigte sich Jahre später damit, dass durch das einfache Grab „dieser große Mann“ der „Verwesung auf dem Leichenhofe“ ausgesetzt war und dass er das Andenken an den Komponisten wahren wollte. Und so gab es „nach dem Gesetze selbst kein Hindernis mehr, das Herrenlose zu ergreifen“. Dass Peter und Rosenbaum jedoch legal den Schädel an sich genommen hatten, wie Peter hier behauptete, war selbst nach damaliger Rechtsprechung nicht richtig – Leichenschändung wurde geahndet.
Aufgeflogen
Dass der Schädeldiebstahl so lange unbemerkt blieb, war reiner Zufall. Fürst Nikolaus II. Esterházy wollte schon ein halbes Jahr nach Haydns Tod eine Überführung der Gebeine nach Eisenstadt vornehmen, doch das Vorhaben verzögerte sich.
Erst als der Duke of Cambridge im September 1820 bei Esterházy zu Gast war, soll der Fürst durch einen Trinkspruch des Dukes an sein Vorhaben erinnert worden sein. Jedenfalls beschrieb es Peter so:
Fürst Esterházy war aber eben nicht im „Besitze der irdischen Reste“ Haydns. Ob tatsächlich der irrtümliche Ausspruch seines Gastes dazu geführt hatte, dass er den Plan einer Überführung wieder aufnahm, sei dahingestellt. Fest steht, dass die erneute Exhumierung am 30. Oktober 1820 den Schädeldiebstahl auffliegen ließ.
Zunächst ließ man nach der Exhumierung des restlichen Körpers noch Zeit verstreichen, schließlich liefen ja sofort Ermittlungen an. Doch als nach ein paar Tagen der Schädel immer noch nicht gefunden wurde, beschloss Nikolaus II., vorerst nur die übrigen Gebeine nach Eisenstadt zu bringen. Rosenbaum, fleißig die Ereignisse beobachtend, schrieb hämisch in sein Tagebuch:
Acht Tage nach der Exhumierung fand am 7. November 1829 ein feierlicher Festakt in Eisenstadt statt: In der Bergkirche wurde ein großes Trauergerüst aufgestellt, der fürstliche Hofstaat, die Leibgarde, die Franziskanermönche, die jüdische Gemeinde und die Eisenstädter Bevölkerung fanden sich ein. Unter den dramatischen Klängen von Mozarts Requiem wurde Haydn in der Gruft an der Südseite der Kirche beigesetzt – der Kopf fehlte jedoch immer noch.
Am selben Tag erhielt Rosenbaum eine Warnung:
Unter Druck
Polizeidirektor Dumbacher konnte seine heiße Spur auf Peter zurückverfolgen und stattete ihm am 11. November persönlich einen Besuch ab. Peter wehrte ab, er habe zwar eine Sammlung an Schädeln gehabt, doch die musste er bis auf zwei Exemplare aufgeben. Die Annahme, dass die Polizei anschließend bei Rosenbaum eine Hausdurchsuchung gemacht und Rosenbaum den Schädel im Strohsack unter dem Bett seiner Frau versteckt hätte, ist allerdings in den Quellen nicht belegt. Daher muss wohl auch die angebliche Ausrede seiner Frau der Polizei gegenüber, sie könne das Bett nicht verlassen, weil sie menstruiere, ins Reich der Fantasie verwiesen werden.
Nach dem Verhör lief Peter vielmehr zu Rosenbaum, der in sein Tagebuch schrieb:
Glaubt man Rosenbaum, so lagen die Nerven bei Peter am nächsten Tag bereits blank:
Inzwischen hatte auch Fürst Esterházy vom verdächtigten Peter erfahren. Er ließ ihm ausrichten, dass er ihn reichlich entlohnen werde, wenn er den Schädel herausgäbe. Peter wandte sich also abermals an Rosenbaum, zumal er am 14. November wohl eine neuerliche Aufforderung Dumbachers erhielt, den Totenkopf auszuhändigen. Schließlich beschlossen Peter und Rosenbaum, einen Schädel auszuhändigen. Die Geschichte, dass die beiden erst einen Kopf aushändigen, der sich nach Überprüfung jedoch – je nach Erzähler variierend – als der einer jungen Frau, eines jungen Mannes oder eines Kindes herausstellte, ist quellenmäßig nicht haltbar. Rosenbaum und Peter gaben vielmehr einen passenden Totenkopf her. Der zweite Wiener Stadtphysikus Dr. Joseph Edler von Portenschlag-Ledermayer überprüfte diesen nämlich und stellte fest, dass er von einem Greis stammen müsste. Haydns Schädel, so meinte man, war gefunden. Am 29. November 1820 wurde er zu den übrigen Gebeinen in die Gruft der Eisenstädter Bergkirche gelegt. Von der versprochenen „fürstlichen Belohnung“ erhielt Peter laut eigenen Angaben nichts.
Noch lange nicht das Ende der Geschichte
Rosenbaum und Peter hatten die Behörden getäuscht. Nicht Haydns Schädel hatten sie ausgehändigt, sondern der Kopf eines Unbekannten ruhte nun neben Haydns Körper in Eisenstadt. Der echte Schädel war immer noch bei Rosenbaum und dieser wahrte das Geheimnis bis zu seinem Tod im Jahr 1829. Erst am Sterbebett vertraute er ihn wieder Peter an:
Ob Rosenbaum Nikolaus II. Esterházy das Hinauszögern der Heiratserlaubnis und die Entlassung auch am Totenbett noch übelnahm? Jedenfalls wollte er Haydns Haupt nicht in den Händen des Fürsten wissen. Peter übernahm den Schädel, doch er bestimmte, dass dieser erst nach seinem eigenen Tod an das Musikkonservatorium gehen soll, um „vor Verfolgung mich zu bewahren“. Peter starb 1838 und seine Witwe übergab den Kopf, vermutlich auch aus Angst vor weiteren Ermittlungen, an dessen behandelnden Arzt Dr. Carl Haller.
Haller behielt den Schädel bis 1852 und reichte ihn dann dem Professor der pathologischen Anatomie, Carl Freiherr von Rokitansky, weiter. Er begründete dies damit, dass der Kopf in einem von Rokitansky geplanten Museum für Pathologie und Anatomie einen würdigen Platz finden würde.
Carl Rokitansky verwahrte Haydns Schädel jedoch bis zu seinem Tod bei sich zu Hause auf. Erst 1878 wurde das Craniumdem tatsächlich verwirklichten pathologisch-anatomischen Museum als kurioses Schauobjekt zur Verfügung gestellt.
1893 wandte sich der nunmehrige Direktor des Museums, Dr. Hanns Kundrat, an die Erben Rokitansky, um die unklaren Besitzverhältnisse zu klären. Diese beschlossen, den Schädel der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien zu übergeben – also dem bereits von Peter zum zukünftigen Besitzer auserkorene Wiener Musikkonservatorium.
Unter der Bedingung, dass der Verein im Falle einer Auflösung das Cranium „samt allen Pertinenzen und Dokumenten der Stadt Wien für deren historisches Museum zu übergeben“ habe, wurde Haydns Haupt im Jahr 1895 für 59 Jahre Museumsobjekt in der Gesellschaft der Musikfreunde.
Versuche einer Zusammenführung der Gebeine
Kritik am Verfahren mit Haydns Schädel wurde schon in den Haydn-Gedenkjahren 1882 und 1884 laut. Doch erst 1908/1909 kamen sowohl von Wiener als auch Eisenstädter Seite Pläne für eine Zusammenführung der sterblichen Überreste, die allerdings scheitern. Fürst Esterházy wollte die Gebeine nicht nach Wien bringen lassen, während Wien Bedenken hatte, den Schädel in den ungarischen Teil der Monarchie zu überführen.
1929 – das Burgenland war seit knapp sieben Jahren jüngstes Bundesland der Republik Österreich – erreichte die Gesellschaft der Musikfreunde ein Antrag des burgenländischen Landeshauptmannstellvertreters, den Kopf doch Eisenstadt zu überlassen. Die Gesellschaft verneinte: Wien sei als Zentrum der Musikkultur der geeignetere Ort für eine solch kostbare Reliquie.
1931 ließ Dr. Paul Esterházy ein Mausoleum in der Bergkirche errichten, um Haydn dort neuerlich zu bestatten. Auch hier scheiterte eine Zusammenführung von Körper und Schädel am Gegenwind der Gesellschaft der Musikfreunde. Das fertig gestellte Mausoleum blieb vorerst leer und wurde versperrt. Ein ähnliches Vorhaben, am Wiener Zentralfriedhof ein Doppelmausoleum für Mozart und Haydn zu errichten, erhielt kaum Unterstützung.
Als die zunehmende wirtschaftliche Krise der 1930er Jahre die Gesellschaft der Musikfreunde beinahe bankrottgehen ließ, erwog diese den Verkauf des Kopfes. Doch auch dieser Plan ging nicht auf: Der Verkaufsbetrag in einem Kompromissvorschlag mit Fürst Esterházy war der Gesellschaft zu gering.
Zu Zeit des Nationalsozialismus wurde zunächst eine Überführung des Schädels nach Eisenstadt vehement durch die burgenländische NSDAP gefordert und auch eine Einigung erzielt. Aufgrund der Eskalation der Kriegsgeschehnisse 1941 verfolgte man die Angelegenheit bis nach Kriegsende jedoch nicht mehr weiter.
Auch nach 1945 wollte man vorerst das Haupt Haydns nicht ins Burgenland und damit in die sowjetische Besatzungszone schicken. Erst das Jahr 1953 läutete eine erfolgreiche Zusammenführung der Gebeine und des Schädels ein.
1954: Endlich vereint
Unter der Direktion der Gesellschaft der Musikfreunde fand mit Präsident Dr. Alexander Hryntschak und Generalsekretär Rudolf Gamsjäger eine Wendung der Ereignisse statt. Sie konnten am 26. November 1953 einen endgültigen, einstimmigen Beschluss der Gesellschaft erringen, den Schädel freizugeben. Der lange Irrweg des Haydn-Kopfes sollte endlich in Eisenstadt sein Ende finden.
Dort war man sich einig:
Ein Appell an die burgenländische Bevölkerung, sich und Eisenstadt von der besten Seite zu zeigen, ging hinaus:
Der Sarg mit dem echten Körper und dem falschen Schädel wurde am Tag vor den groß angekündigten Feierlichkeiten aus der Gruft der Eisenstädter Bergkirche geholt. Den Kopf des Unbekannten entnahm man und legt ihn in die Gruft zurück. Heute erinnert eine Gedenktafel an das Haupt jenes Mannes, das knapp 134 Jahre lang mit dem Körper Haydns bestattet war. Die sterblichen Überreste Haydns wurden in einen Kupfersarg umgebettet und bis zur Schädelbeisetzung am nächsten Tag vor dem Hochaltar der Bergkirche aufgebahrt.
Am 5. Juni 1954 war es so weit: Haydns Schädel wurde von Wien nach Eisenstadt überführt. Dem Wagen folgten 130 Limousinen. Nach einer Zwischenstation in Haydns Geburtsort Rohrau traf die Kolonne in Eisenstadt vor dem Schloss Esterházy ein. Mit einem Festzug wird die Reliquie zur Bergkirche getragen. Dem Bildhauer Gustinus Ambrosi wurde die Ehre zuteil, den Schädel Haydns zu den restlichen Gebeinen zu legen. Ambrosi hielt den langgereisten Kopf ein letztes Mal in die Höhe, präsentierte ihn den andächtigen Festgästen in der Kirche. Klicken der Fotoapparate, Blitzlichtgewitter, Spannung im Raum – dann senkte Ambrosi den Schädel in den Sarg hinab. Kopf und Körper hatten endlich zueinandergefunden.
Der Sarg wurde ins Mausoleum der Bergkirche getragen, wo er auch heute noch liegt. Nicht umsonst trägt die Bergkirche nun auch den Namen Haydnkirche, wo der große Komponist endlich seine letzte Ruhe fand – nach 145 Jahren.